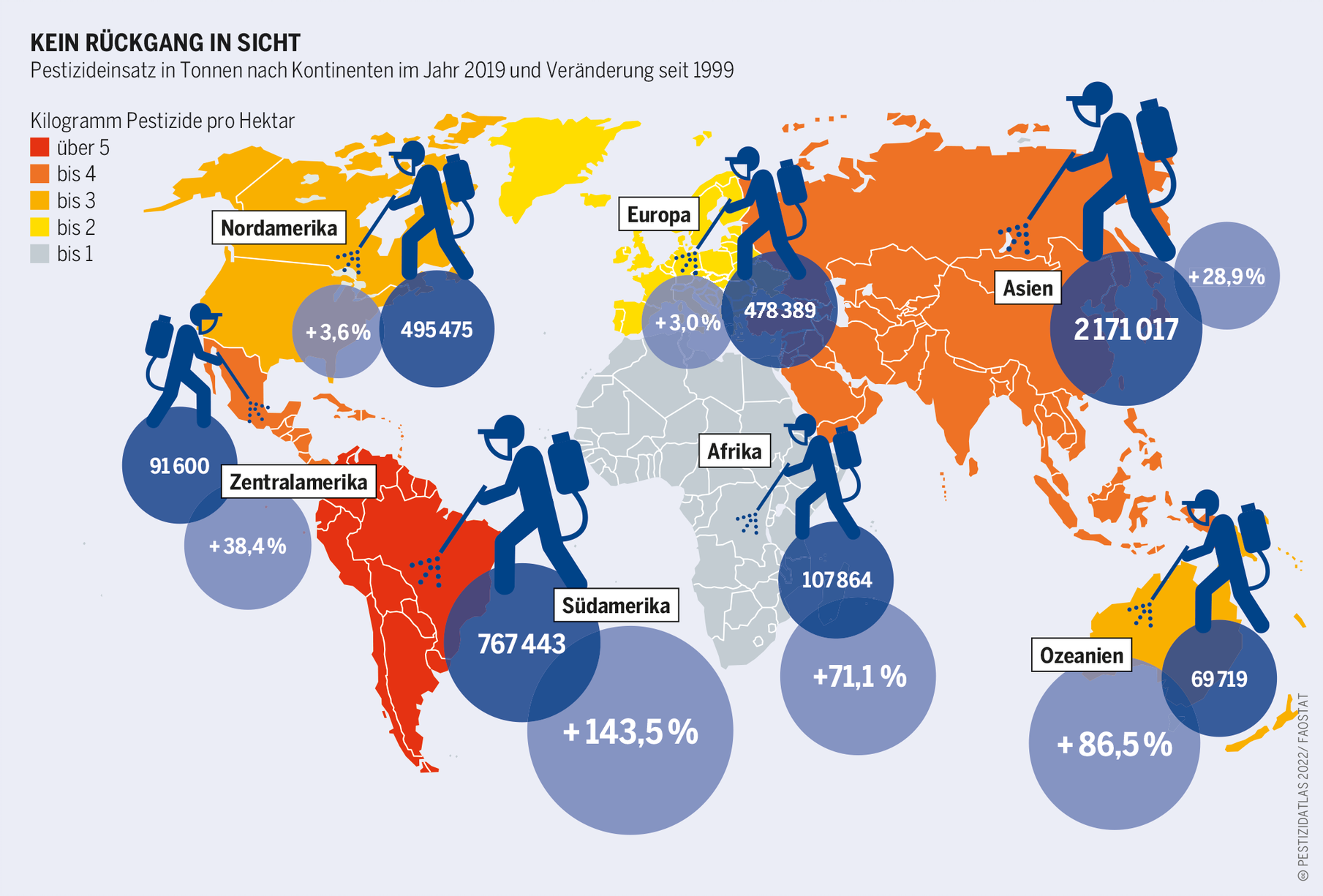Isemann Holistic Guidance ist neu Partner des One Planet Lab – Gemeinsam für echte Transformation
Themenbereiche
Isemann Holistic Guidance ist neu Partner des One Planet Lab – gemeinsam für echte Transformation
Das One Planet Lab und Isemann Holistic Guidance passen zueinander wie permakultureller Boden zu lebendiger Vielfalt! Beide Organisationen setzen sich mit ganzer Kraft für eine enkeltaugliche Welt ein. Die neue Partnerschaft ist mehr als ein strategisches Bündnis – sie basiert auf einem 100%igen Werte- und Projekt-Match. Ob Gemeinwohlorientierung, systemisches Denken oder radikal umsetzbare Nachhaltigkeit – hier treffen sich zwei Kulturen, die sich gegenseitig stärken und ergänzen.
One Planet Lab: ein Netzwerk für den Wandel
Das One Planet Lab ist ein schweizweites Innovationslabor, initiiert vom WWF Schweiz. Es schafft Räume, in denen Menschen ressourcenleichte Lebensstile ausprobieren, wirtschaftliche Alternativen testen und Zukunft erproben. Ziel ist eine Gesellschaft, die mit nur einem Planeten auskommt – ökologisch tragfähig, sozial gerecht und wirtschaftlich resilient.
One Planet Lab bringt Akteurinnen und Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen: NGOs, Start-ups, Forschungsinstitute, Bildungsprojekte, Landwirtschaft, zukunftsorientierte Unternehmen. Sie alle verbindet die Frage: Wie schaffen wir gemeinsam einen Systemwandel?
Wichtig sind dabei drei Dinge:
- Wissen teilen – über Blogbeiträge, Leitfäden, Kurse und Best Practices.
- Menschen vernetzen – auf Events, durch Partnerschaften oder informelle Austauschformate.
- Projekte fördern – in Testfeldern, durch Beratung oder kollaborative Experimente.
Ob «Regio Challenge», Soils Assembly, Doughnut-Ökonomie oder neue Beteiligungsformate für Bürgerinnen und Bürger – One Planet Lab übersetzt Nachhaltigkeit in handfeste Praxismodelle.
Warum der Zusammenschluss?
Isemann Holistic Guidance bringt eine einzigartige Kombination aus systemischer Beratung, regenerativer Landwirtschaft, Organisationsentwicklung und Finanzinnovation ins Netzwerk. Besonders spannend wird es dort, wo RegioWert AG und AgriMetrix ins Spiel kommen – zwei Projekte, die genau die Lücken füllen, die auch One Planet Lab adressiert:
RegioWert AG: Regional investieren, Wandel finanzieren
Die RegioWert AG verbindet Menschen, die ihr Geld für gesunde Böden, faire Lebensmittelproduktion und lebendige Regionen einsetzen wollen. Durch direkte Investitionen in Boden und Infrastruktur regionaler Betriebe entstehen starke, resiliente Wertschöpfungsketten. Das Konzept wurde in Deutschland erprobt, von Isemann Holistic Guidance und Partnern weiterentwickelt und nun in die Schweiz gebracht.
One Planet Lab setzt sich seit jeher für regionale Ernährungssysteme ein. Veranstaltungen wie das Regio-Bankett, Partnerschaften mit der Kleinbauern-Vereinigung oder Projekte zur Proteinwende zeigen, wie sehr regionale Souveränität im Zentrum steht. Die RegioWert AG liefert hier ein echtes Finanzierungsinstrument mit Commons-DNA. Ein Match auf allen Ebenen.
AgriMetrix: Zukunftstauglichkeit messbar machen
Mit AgriMetrix wird sichtbar, was viele Höfe bereits leisten: Biodiversität erhalten, Böden pflegen, soziale Verantwortung übernehmen. Das von der RegioWert Treuhand AG verwaltete Tool AgriMetrix bewertet auf knapp 400 Indikatoren, wie ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig ein Hof wirtschaftet – und schafft damit die Grundlage für faire Entlohnung, gezielte Förderung und transparente Kommunikation.
Das One Planet Lab-Netzwerk diskutiert genau solche Fragen: Wie können wir Wirkung messen? Wie lassen sich Donut-Indikatoren in die Praxis bringen? Wie entsteht ein Wirtschaften innerhalb planetarer Grenzen? AgriMetrix liefert hier ein robustes, anwendbares System, das One Planet Lab-Akteurinnen und -Akteuren konkrete Umsetzungshilfe gibt.
Partner, Projekte, Perspektiven – wie du dich einbringen kannst
Mit über 80 Partnern bietet das One Planet Lab eine enorme Vielfalt an Initiativen, in die du dich einbringen kannst – als Mitdenker:in, Mitmacher:in oder Mitgestalter:in.
scaling4good
scaling4good ist ein Think-and-Do-Tank, der – genau wie Isemann Holistic Guidance – auf ganzheitliche Lösungen innerhalb der planetaren Grenzen setzt. Die Initiative vernetzt Menschen und Organisationen, um nachhaltige Projekte zu vergrössern und echten gesellschaftlichen Wandel zu bewirken. Besonders schön: Katrin Hauser von scaling4good und ich haben 2021 gemeinsam eine Permakultur-Ausbildung gemacht.
OstSinn
OstSinn ist eine Plattform für Nachhaltigkeit in der Ostschweiz und passt ausgezeichnet zu unserem Engagement für regionale Lösungen. Dank OstSinn konnte ich kürzlich an einer Projektschmiede in St.Gallen die Idee einer ersten Schweizer RegioWert AG vorstellen – ein Konzept, an dem ich aktiv mitwirke, um die regionale Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit OstSinn ist für Isemann Holistic Guidance besonders wertvoll, weil sie zeigt, wie wir gemeinsam Menschen vor Ort für zukunftsfähige Ideen begeistern können.
Ökozentrum
Das Ökozentrum fördert Innovation und Bildung im Nachhaltigkeitsbereich. Besonders inspiriert mich ihr Projekt «Zukunft schreiben», bei dem engagierte junge Menschen für Abschlussarbeiten rund um Nachhaltigkeit ausgezeichnet und begleitet werden. Dieses Programm zeigt eindrücklich, wie wichtig die nächste Generation für eine enkelfähige Zukunft ist – eine Vision, die ich voll und ganz teile.
GreenBuzz
GreenBuzz ist ein lebendiges Netzwerk von Nachhaltigkeitsbegeisterten, in dem auch Isemann Holistic Guidance Mitglied ist. Als Teil dieser Community tausche ich mich projektbezogen mit Gleichgesinnten aus und lasse mich von neuen Ideen inspirieren. GreenBuzz passt perfekt zu uns, weil hier die Freude am gemeinsamen Lernen und Handeln für eine bessere Zukunft im Vordergrund steht – jede Veranstaltung liefert neue Impulse und motiviert, dranzubleiben.
öbu
öbu ist das Schweizer Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, bei dem ich ebenfalls Mitglied bin. Im Kreis der öbu-Mitglieder – Unternehmen, die Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen – fühle ich mich gut aufgehoben.
Purpose Stiftung
Die Purpose Stiftung setzt sich dafür ein, Unternehmen im Verantwortungseigentum (auch Purpose Ownership genannt) zu begleiten – also Firmen, die ihrem Zweck und nicht primär dem Profit verpflichtet sind. Mit Purpose arbeiten wir aktuell Hand in Hand daran, neue Unternehmen zu gründen, die genau dieses Prinzip leben. Diese Partnerschaft passt perfekt zu Isemann Holistic Guidance, weil sie zeigt, wie wir Wirtschaft neu denken können: gemeinwohlorientiert, langfristig und sinngetrieben. Ich bin begeistert, Teil dieses Netzwerks zu sein und zusammen mit Purpose echte Pionierarbeit für zukunftsfähiges Unternehmertum zu leisten.
Swiss Donut Economics Network
Das Netzwerk der Swiss Donut Economics bringt Menschen zusammen, die eine Wirtschaft denken und leben wollen, die soziale Gerechtigkeit und ökologische Grenzen zusammenbringt. Ich schätze besonders die Offenheit und Tiefe der Diskussionen – sie geben wichtige Impulse für unsere Arbeit mit AgriMetrix und RegioWert. Die Donut-Logik ist für mich mehr als ein Modell, sie ist ein Kompass.
Acker Schweiz
Acker Schweiz bringt Kindern und Jugendlichen bei, wie Landwirtschaft funktioniert – praxisnah, im eigenen Schulgarten. Das berührt mich sehr, weil ich selbst oft erlebe, wie stark ein früher Bezug zu Natur und Ernährung das Denken fürs Leben prägt. Bildungsprojekte wie dieses legen die Basis für eine Gesellschaft, die wieder mit der Erde in Beziehung tritt.
Protein Transition Switzerland
Bei Protein Transition Switzerland geht es um nichts weniger als die Ernährungswende – hin zu einer pflanzenbasierten, ökologisch sinnvollen Proteinversorgung. Ich sehe grosse Synergien zur Arbeit von AgriMetrix und bin überzeugt, dass dieser Wandel auch kulturell begleitet werden muss. Dieses Projekt macht Mut und zeigt, wie Veränderung konkret aussehen kann.
CircularHub
Der CircularHub hilft Unternehmen, in zirkulären Kreisläufen zu denken und zu handeln. Für mich ist das besonders relevant in der Zusammenarbeit mit Betrieben, die über RegioWert oder Purpose neue Geschäftsmodelle aufbauen. Es braucht Orte wie diesen, die Know-how und Netzwerk vereinen, um die Theorie in die Praxis zu bringen.
Ob du dich für Bodenaufbau, regenerative Ernährungssysteme oder wertebasiertes Investieren interessierst – irgendwo in unseren Netzwerken findest du Gleichgesinnte.

Kai Isemann
Mein Denken ist in der systemischen Finanzwelt gewachsen – tief analytisch, lösungsorientiert und geprägt von einem Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Heute begleite ich Menschen, Organisationen und Regionen in Transformationsprozessen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Strukturen in einen nachhaltigen Gleichklang bringen.
Eine grosse Freude an der Neurodiversität – an den unterschiedlichen Arten, die Welt zu denken und zu gestalten – fliesst ebenso in meine Arbeit, wie die Überzeugung, dass Vielfalt die Grundlage für Resilienz und Innovation ist. Weiterbildungen in permakultureller und syntropischer Landwirtschaft sowie die Bewirtschaftung eines eigenen Waldgartens ermöglichen es mir, agrarökologische Entwicklungen praxisnah zu gestalten und Theorie und Umsetzung sinnvoll zu verbinden.
Grundlage meines Handelns sind die Prinzipien der Triple Bottom Line: ökologisch tragfähig, sozial gerecht und wirtschaftlich tragend – mit dem Ziel, individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Resilienz gleichermassen zu fördern.
Weitere Impulse aus meinem Universum