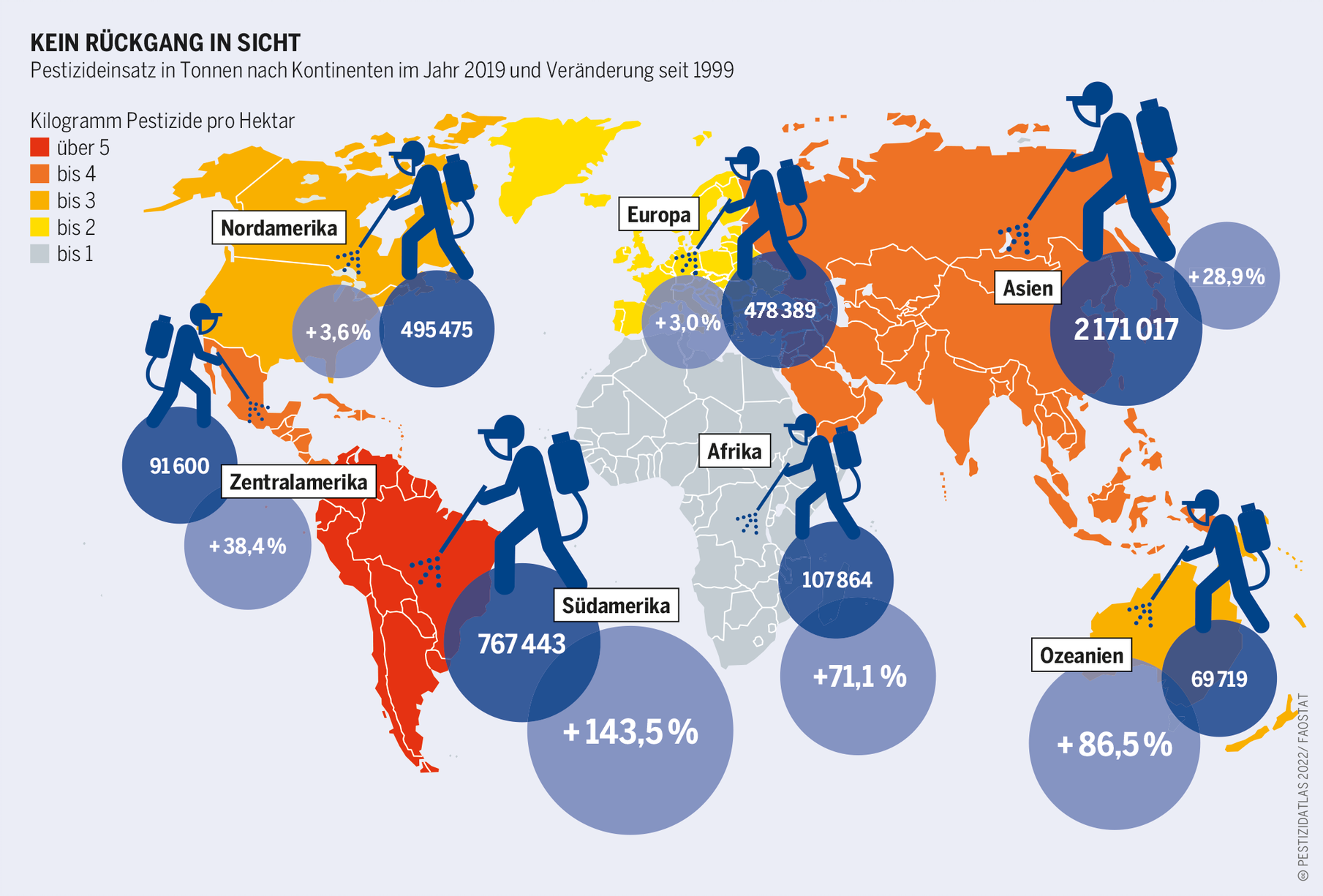Statistisch betrachtet erkranken mindestens 25 Prozent der Bevölkerung, also jeder Vierte, einmal im Leben an einer psychischen Störung, die einer Behandlung bedarf. Die Auslöser sind vielfältig und die Auswirkungen auf das private wie berufliche Leben können einschneidend sein. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an Kontakt-, Kommunikations- und Interaktionsstörungen, welche sozial massiv einschränken können. Obwohl das Unterstützungsangebot in der Schweiz im internationalen Vergleich durchaus positiv auffällt, besteht eine immense gesellschaftliche Herausforderung darin, passende kreative Angebote für diese Bevölkerungsteile am Rand der Gesellschaft sicherzustellen und Betroffene zu integrieren.
In diesem Artikel möchten ich Betroffenen und Angehörigen, aber auch Ärzten, Einrichtungen, Verbänden und Verwaltungen Einblick in ein kreatives neues Angebot professioneller Beratung und Unterstützung aufzeigen. Er soll den Zugang zum Thema erleichtern, Möglichkeiten der Entlastung aufzeigen und bei der Suche nach passgenauen Angeboten unterstützen.
Der Verlauf einer psychischen Erkrankung wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Die Kenntnis neuer Hilfsangebote kann dazu beitragen, dass frühzeitig passgenaue Schritte zur Stabilisierung der eigenen Gesundheit sowie des beruflichen und sozialen Umfelds erfolgen können. Die hier aufgeführte Möglichkeit unterstützt einen kreativen Prozess in Abstimmung mit weiteren Angeboten.
Was ist eine Gesellschaft?
Ist sie eine Ansammlung von sozialen Riten und Sitten, die sich evolutionär zu der momentanen sozialen Struktur entwickelt hat? Oder ist sie etwas, das sich nicht als besser, aber als beständiger als andere Formen des Zusammenlebens erwiesen hat? Oder vielleicht ist eine Gesellschaft eine Ansammlung von Menschen, die genug Eigenschaften teilen, freiwillig oder gezwungenermassen, sodass sie als Teil einer Gruppe gelten?
Die letztere Definition greift vielleicht nicht in den tiefen Sinn der Sache aber spiegelt die Realität wohl am besten: Bei einer Gesellschaft handelt es sich um eine geschlossene Gruppe von Menschen.
Nun, um eine Gruppe definieren zu können, muss es auch Menschen geben, die nicht Teil dieser Klassifikation sind. In jeder existierenden Definition steckt die implizite Prämisse deren Negation. Im einfachsten Sinn definiert sich eine Gruppe durch die Nicht-Zugehörigkeit von anderen. Aber wie regelt eine Gesellschaft diese Exklusion, dieses Nicht-Dazugehören?
Jede Gesellschaft hat Normen, intrinsische oder artifizielle. Menschen, die nicht in die Gesellschaft gehören oder von dieser gar ausgeschlossen werden, sind die Menschen, die den Normen der Gesellschaft nicht entsprechen. Seien diese Normen jetzt beeinflussbar: Schnurrbart, Kleidung, politische Meinung; oder nicht: Hautfarbe, Familie. Menschen werden oft auf einzelne Eigenschaften reduziert und abgetan. Weitere Dimensionen auf dieser unendlichen Klaviatur einer Persönlichkeit erkennen nur Wenige.
Randzonen sind ein intrinsischer Teil von Gesellschaften. Es kann niemanden geben, der in eine Gesellschaft passt, wenn es niemanden gibt, der dies nicht tut.
Psychologen verwenden den Begriff “Sozialisierung”, um den Prozess zu bezeichnen, durch welchen Kinder dazu erzogen werden, so zu denken und zu handeln, wie es die Gesellschaft verlangt. Ein Mensch gilt als gut sozialisiert, wenn er an den Kodex seiner Gesellschaft glaubt und ihm gehorcht.
Das Problem von heute liegt darin, dass unsere komplizierte Welt der globalen Wirtschaft und des bürokratisierten Zusammenlebens viele Regeln erfordert. So viele Regeln, dass jemand, der sich an alle Regeln halten würde, übersozialisiert und eindeutig neurotisch wäre. Solche Menschen gibt es durchaus, Menschen, die den Regeln, die sie umschwirren, nicht entkommen können und sich Phantasmen ausdenken müssen, um durch sie ihre Persönlichkeit auszuleben. Andere wiederum lehnen sich gegen diese Regeln komplett auf. Die meisten verstehen aber wohl, dass man nicht allen Regeln gehorchen kann und gönnen sich selbst kleine Ausflüchte: Beneiden, wo man nicht beneiden sollte, versagen, wo man nicht versagen sollte, lügen, wo man nicht lügen sollte. Wie gewünscht, angepasst, mit ein paar ‘Imperfektionen’.
Alle diese drei Gruppen erfahren ihre ganz eigenen Frustrationen, denn ein Leben in solch einer komplexen und grossen Gruppe ist nicht das, wofür uns unsere Geschichte und Biologie erschaffen hat.
Aus dieser permanenten Frustration und sozialen Angespanntheit hat sich die heutige Gesellschaft entwickelt. Es fehlt uns vor allem anderen an der einfachen Kausalität und Autonomie von gestern, die unserem Leben einmal Sinn verliehen hat.
Wege, wie man seine menschlichen Bedürfnisse auslebt, ohne dass unser eigenes Gehirn unsere Mühen als abstrakte Zeitverschwenderei einstufen würde, gibt es wenige. Ist es ein Wunder, dass wir in einer zutiefst gestörten Gesellschaft leben und eine beachtliche Depressions-, Suizid- und Neurotiker-Rate haben?
Auch für Menschen am Rand der Gesellschaft gibt es Verfahren, wie mit ihnen umzugehen ist. Es gibt für alles Verfahren. Und es gibt Therapien und Medikamente, viele Medikamente. Für was? Um uns besser parieren zu lassen? Uns wird dazu noch suggeriert, dass wir dankbar sein müssen für all diese Verfahren. Die Frage, die man sich erlauben darf ist, „Ist das System, welchem wir hier blind vertrauen, gut genug, um dafür dankbar sein zu müssen?
Erlauben wir uns einen kleinen Ausflug durch den Diagnoseprozess der Psychologischen Universitätsklinik Zürich für Asperger-Autismus-dynamische Menschen – definitiv solche aus der Randzone.
Aufgrund traumatischer Erfahrungen in den Jahren 2018/2019 befand ich mich in psychotherapeutischer Behandlung und „auf dem Weg“ wurde mir eine ADHS/Asperger-dynamische Persönlichkeit «zugesprochen».
Stell‘ dir also vor, du bist eine Person Ende Vierzig. Manchmal wirkst du ein wenig unkonzentriert. So warst du schon immer. In der Schule warst du eher schlecht als recht. Du entspricht oft nicht der „Norm“. Soziale Interaktionen sind nicht einfach. Freunde? Mangelware. In Themengebieten, in welchen du dich auskennst, hast du ein gewisses Charisma, was dich einigermassen erfolgreich durch das Leben begleitet. Dir gefällt irgendwie, wer du bist. Weil, am Ende des Tages kannst du ja schliesslich auch niemand sonst sein. So viel Erkenntnis hast du gewonnen.
Das Leben läuft, abgesehen von einer tendenziell höheren Volatilität als „normal“, eigentlich ganz in Ordnung, bis du durch eine sehr schwierige Phase deines Lebens gehst. Traumatisiert, aber bereit dich wieder einzugliedern, suchst du nach professioneller Hilfe.
So wirklich verstanden fühlst du dich bei all den Gesprächen aber nicht. Du wechselst die Ansprechperson. Dann nochmals. Und nochmals. Nach zwei Jahren Wanderschaft durch viele Praxen findest du dich bei der PUK in Zürich wieder, mittendrin gleich neben dem Hauptbahnhof. Dir kommt der Impuls, dass man erwarten könnte, dass sich die Psychologische Universitätsklinik bei der Auswahl der Örtlichkeiten für ihre Profit Center ein wenig Gedanken gemacht hat. Was aber eben dieser Gedanke war, Menschen in der anfälligsten Phase ihres Lebens an einen Ort zu dirigieren, welcher an Reizüberflutung nur einem Flughafen hinterherhinkt, das erschliesst sich dir nicht.
Dieser Diagnoseprozess verbleibt auch bei der nächsten Etappe eher mysteriös. Selbst nicht zu gross gewachsene Menschen dürfen sich demütig bückend unter einem massiven Sandstein-Türrahmen hindurchfügen. Für Menschengruppen mit tendenziell tiefem Selbstvertrauen und einer Übersensorik, eine mehr als symbolische Geste. Der Blick hebt sich wieder. Synthetische, abwaschbare Wände, die bereits in den 1980er Jahren zu grell waren, synthetischer Bodenbelag in anderer greller Couleur. Nun, du weisst hier schnell, wer du bist und was du bist. Und du willst eigentlich gar nicht hier sein.
Etwas Seltsames zieht sich durch den gesamten Diagnoseprozess: „Die meisten Menschen tun dies oder das. Wie reagieren Sie in dieser Situation?“ hörst du ständig. Du wunderst dich: „Sollte ich mich wirklich blind an den meisten Menschen ausrichten? Wenn ja, wieso? Nur weil durch diese Norm eine gewisse soziale Akzeptanz möglich ist? Will ich diese überhaupt erreichen? Wenn ja, zu welchem Preis? Und wie gehe ich mit der Tatsache um, dass die meisten Menschen meist irren?“, was dieselben Promovierten an anderer Stelle belegen. In deinem Kopf echot die Stimme deiner Rechtsverdreherin: „Recht haben und Recht bekommen haben nichts miteinander zu tun. Der Unterschied liegt im Umfang Ihres Portemonnaies.“ Das schmerzt. Ist diese Tatsache doch der Grund für deinen aktuellen Status.
Alles in allem hast du dich in den letzten Jahren mit über 20 Psychiatern, Psychoanalytikern, Psychotherapeuten etc. ausgetauscht. Deine Geschichte ist ebenso oft neu interpretiert und jedes Mal ergeht daraus eine ganz eigene, subjektive Diagnose, so sehr man auch versucht, alles in Rahmen und Kästchen zu packen. Glauben wir wirklich, dass wir dazu in der Lage sind, die Persönlichkeit eines Menschen zu lesen? Abschliessend? Offenbar lebet unsere Gesellschaft in diesem Glauben. Welche Erkenntnisse werden aus all diesen Gesprächen hergeleitet? Keine zwei gleichen Meinungen. Die subjektive Wahrnehmung der Welt des Verhörten und verschiedene Therapieansätze führen zu 20 verschiedenen Diagnosen.
Und in diesem Fall, bei mir? ADHS/Asperger-dynamisch ja oder nein? Nun, ich kann es mir aussuchen, je nach dem wem ich mehr Glauben schenke. Manchmal so, manchmal so. Tendenziell ist das System daran interessiert, einen beizubehalten. Die Rufe nach mehr Kliniken und mehr Arzneimittelzulassungen werden lauter. Klar. Diese Branche ist ein wichtiger Bestandteil des BIP (Bruttoinlandsprodukt) einer Gesellschaft. Und da die Wertungen sehr subjektiv sind, sind sie käuflich. Ein guter Markt.
Der gesamte Prozess, von der Diagnose bis zur Behandlung, scheint kaum irgendwo dem Hypokratischen Eid zu dienen. Er ist eine Chronologie pathologischer Missverständnisse und vorhersehbarer Degradierungen. Wer nicht schon depressiv war, ist es gerne danach. Resultat: vergeudete Zeit und Energie, welche an anderer Stelle viel mehr bewirken könnte. In den meisten Fällen wird am Ende gerne Richtung Pharma verwiesen, Ritalin für die Kleinen, Concerta für die Grossen, dazu ein Antidepressivum? Hauptsache, ruhigstellen, sedieren, ins Abseits drücken. Was glauben wir damit erreichen zu können? Essenz ist nicht die Erkenntnis, dass die natürliche Sensorik eines Menschen wertgeschätzt werden sollte, vielleicht sogar gepriesen. Nein, unsere Erkenntnis ist, dass Menschen mit mehr als nur einer singulären Bewusstseinsebene oder einer besonderen Sensorik ein gesellschaftliches Fehlprodukt sind, das zurechtgestutzt werden muss. Konformität. Zurück in die Normen. In eigenem Interesse, sagen sie.
Als Aussenseiter zu leben ist bestimmt eine schwerere Bürde als Teil der Gesellschaft zu sein. Demnach ist es in individuellem Interesse, sich diesen Vorgaben und Therapien demütig zu unterwerfen, die farbenfrohen Pillen mit unaussprechlichen Namen zu nehmen und sich umzutraineren. Weil, man ist ja offenbar nicht normal. Es ist in gesellschaftlichem Interesse, ein System zu fördern, in welchem die individuellen Interessen des Einzelnen mit dem der Gesellschaft grossflächig übereinstimmen.
Solche Therapie-Konzepte, all unsere Literatur, Lehren und Produkte unterliegen einem konstanten Evolutionsdruck. Tiere und Pflanzen auch. Und wir Menschen mit unseren Genen ebenso. Es überlebt nur das, was sich replizieren kann und in sich die Selbstzerstörung vermeidet. Für eine Gesellschaft bedeutet dies die Exklusion als Druckablassung.
Und hier ist der Fehler: Sie tut dies nicht auf einer Basis, dass hieraus eine kreative Veränderung entstehen würde. Sie tut es mit dem Ansinnen, dass sich Menschen dafür schämen, nicht reinzupassen, ins System. Das führt zu einer grundsätzlich toxischen Beziehung zwischen “Normal” und “Randzone”.
Vor allem die Technologie erlaubt es, den Menschen noch weiter zu strapazieren, immer weiter und weiter bis er nicht mehr kann oder darf. All das ist nichts anderes als eine allumfassende Taktik, um den inneren Zustand einer Person so zu verändern, dass er soziale Bedingungen zu tolerieren bereit ist, die er eigentlich als unerträglich empfinden würde.
Mein Fokus an dieser Stelle auf Randzonen begründet sich damit, dass ich glaube, dass es eben diese Menschen sind, welche die Möglichkeit haben, neu zu denken, Alternativen zum Ganzen zu finden, Missstände und Lösungen zu erkennen, welche Menschen, die im Gleichklang des Systems schwingen, nicht sehen/spüren/hören/fühlen können.
Interessant ist die Beobachtung, dass es die Randzonen in der Natur sind, wo die massivste Entwicklung stattfindet. Genestet, gezeugt, gekämpft, gegessen, gekotet, gestorben und zu neuem, guten Boden geworden, das geschieht alles in der Randzone.
Was wäre, wenn wir Randzonen-Menschen in diese natürlichen Randzonen zurückbringen würden? Begleitet und nah am Boden, der uns nährt und heilt. Anstatt dass wir aus den Randzonen flüchten, sollten wir beginnen, die Erfahrungen, welche darin zu machen sind, für uns zu nutzen.
Überhaupt als Menschen, egal ob in einer Randzone feststeckend oder nicht, sollten wir uns wieder mit unserer Autonomie und der Kausalität des Lebens in Verbindung setzen und versuchen die Bedürfnisfrustrationen abzubauen, die sich in unserer Gesellschaft so gerne in uns hineinschleichen. Wir leiden als Gesellschaft eben an einen Mangel von Autonomie und einfacher Kausalität, also ist es eben genau das, womit wir wieder Erfahrung gewinnen müssen, um uns wiederzufinden.
Die Überflieger, die falsch Diagnostizierten, die richtig Diagnostizierten, die Durchschnittlichen, Mütter, Onkel, Söhne, Töchter. Wir würden alle davon profitieren, die Einfachheit, die das Leben in sich birgt, mit unseren Händen wieder zu spüren.
Wir können die Gesellschaft transformieren, müssen es sogar! Hierin sind wir uns wohl fast alle einig. Das werden wir nur zusammen mit Menschen aus der Randzone schaffen und ganz bestimmt nicht, solange wir gegen sie wirken. Veränderung wird stattfinden. Und sie wird aus der Randzone kommen.
Wir alle sollten Feuerholz spalten oder uns um ein Tier kümmern oder einen Ursamen in einen guten, gesunden Boden drücken, diesen Boden pflegen und hüten und zusammen mit Pflanze und Tier den natürlichen Gleichklang des Universums erleben, in einer Symphonie von Summen und Zwitschern, bis hin zum Zelebrieren der Ernte. Wir sollten uns wieder in Verbindung mit dem bringen, was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein, Empathie, tiefste Befriedigung an einer heilen Natur, von welcher wir Teil sind, Harmonie, Bewegung, Liebe.
Es gibt Orte, welche eben genau hierfür bestimmt sind und es gibt Menschen, die befähigt sind, diese Orte zu hüten und Geplagte aus der Randzone (oder solche, die sich wieder mit dem Leben verbinden wollen) begleiten können.
Interessierst du dich für ein individuell zugeschnittenes Randzonen-Mentoring? Buche mich jetzt!